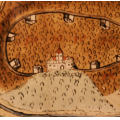1156 wird die - der Reichsabtei Fulda zugehörige - Burg mit Heinrich von Lichtenberg indirekt erwähnt. 1196 kam die L. an Graf Otto I. von Henneberg-Botenlauben, um 1200 dann an die Grafen von Hildenberg, 1228 schließlich an durch Verkauf an das Hochstift Würzburg, das L. 1232 wieder an Fulda abtreten musste. Nachdem die Burg 1366 an die Landgrafen von Thüringen verpfändet worden war, erwarb sie 1409 das Erzstift Mainz, dann 1423 erneut das Hochstift Würzburg. 1525 zerstörten Bauern die Burg, die 1548 an die Grafen von Mansfeld, 1555 an die Herzöge von Sachsen ging. 1638 gehörte die Amtsburg L. zu Sachsen-Weimar, 1662 zu Sachsen-Eisenach, 1741 zu. Sachsen-Weimar-Eisenach. Mit der Verlegung der Amtsvogtei in die Stadt Ostheim 1811 begann der Niedergang der Burg, die Privatleute 1816 auf Abriss erwarben. Den Abbrucharbeiten bereitete Großherzog Karl August 1817 ein Ende, indem er den Bergfried erwarb und sicherte. Ab 1843 kümmerte sich der „Verein zur Erhaltung und Verschönerung der Lichtenburg“ um die Burgruine, die 1945 an den Staat Bayern kam. Die statisch gefährdete Burgruine wurde 2007 und 2008 saniert und erforscht.
Text: Joachim Zeune
Wikipedia: zum Eintrag
Koordinaten: 10.229967, 50.477185
Baugeschichte
Die L. entstand um 1150 als Ringmauerburg mit einem Palas nach Norden und einem kleinen Gebäude am Nordosteck, dem südlich eine Kapelle angebaut war. Der große Bergfried soll jedoch erst um 1330 erbaut worden sein. Im frühen 15. Jhdt. verlegte man das Burgtor von der Ostseite an das Südosteck und flankierte es durch einen Rundturm. Nach der Zerstörung von 1525 verstärkte man die Befestigungen, indem man das Tor mit einem Vorwerk versah und die Ostfront verdickte, was die Aufgabe der Burgkapelle bedingte. Zugleich führte man an der Nordseite einen neuen großen Wohnbau auf. Baudatiert mit 1604 & 1605 baute man den alten Palas („Kemenate“) zu einem Verwaltungsbau um, den man 1739 punktuell überformte. Für 1672 ist eine Bewehrung der Ringmauer durch „sechs neue Blockhäuser“ überliefert (kein Befund), um 1680 richtete man die Stuben neu ein. 1804 schlug der Blitz in den Bergfried ein, der 1849 repariert wurde. Bald nach 1843 errichtete man die 1816 abgerissene Kapelle neu. Sanierungen erfolgten 1882, 1900, 1913, 1963 und 2007/08.
Text: Joachim Zeune
Baubestand
Imposant ragt die Gipfelburg mit ihrem 28 m hohen, weithin sichtbaren Bergfried auf. Gut erhalten hat sich der umlaufende Zwinger mit dem Außentor und dem mächtigen Graben. Kurios ist die Position des quadratischen, sich nach oben verjüngenden Bergfrieds (Seitenlänge 9,6 m; Mauerdicke 2,4 m), der komplett vom Südwesteck der Hauptburg-Ringmauer vorspringt und der große Buckelquader besitzt. Durch eine zweigeschossige Barbakane betritt man den Burghof, der nach Norden von der „Kemenate“ begrenzt wird, dem alten Palas (verbaute Doppelfenster). Von dem ihm später östlich angebauten Wohnbau verbleibt der mächtige Ostgiebel, von der alten Burgkapelle an der Ostseite lediglich der nördliche Innenansatz der Apsis samt romanischem Kapitell. Der im Obergeschoss erneuerte Bergfried ist begehbar, sein Hocheingang öffnet sich in 11 m Höhe. Die Kemenate beherbergt heute eine urige Burgschenke. Unbekannt ist die Bebauung der westlichen Hofhälfte.
Text: Joachim Zeune